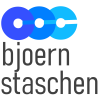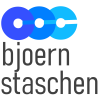In linearen Programmen gibt es “Stolperfallen”: Zur vollen Stunde gibt´s in den meisten Radioprogrammen News. Und im TV sogar in der Länderspiel-Halbzeitpause. Aktiv werden muss nur der, der Nachrichten vermeiden möchte. Bei Netflix & Co. jedoch muss derjenige aktiv werden, der Nachrichten hören oder sehen möchte – ein Paradigmenwechsel.
Daher brauchen wir Stolperfallen für Nachrichten, gerade auf Streaming-Plattformen. Alle Argumente dafür hier.
Monat: Mai 2022
Why We Need “Autoplay” For News
Most radio programmes have news on the hour, and on TV even during the international match half-time break. Only those who want to avoid news have to become active. On Netflix & Spotify however, those who want to listen to or watch the news have to become active – a paradigm shift. Therefore we need “stumbling blocks” for news, especially on streaming platforms. Here are my arguments: